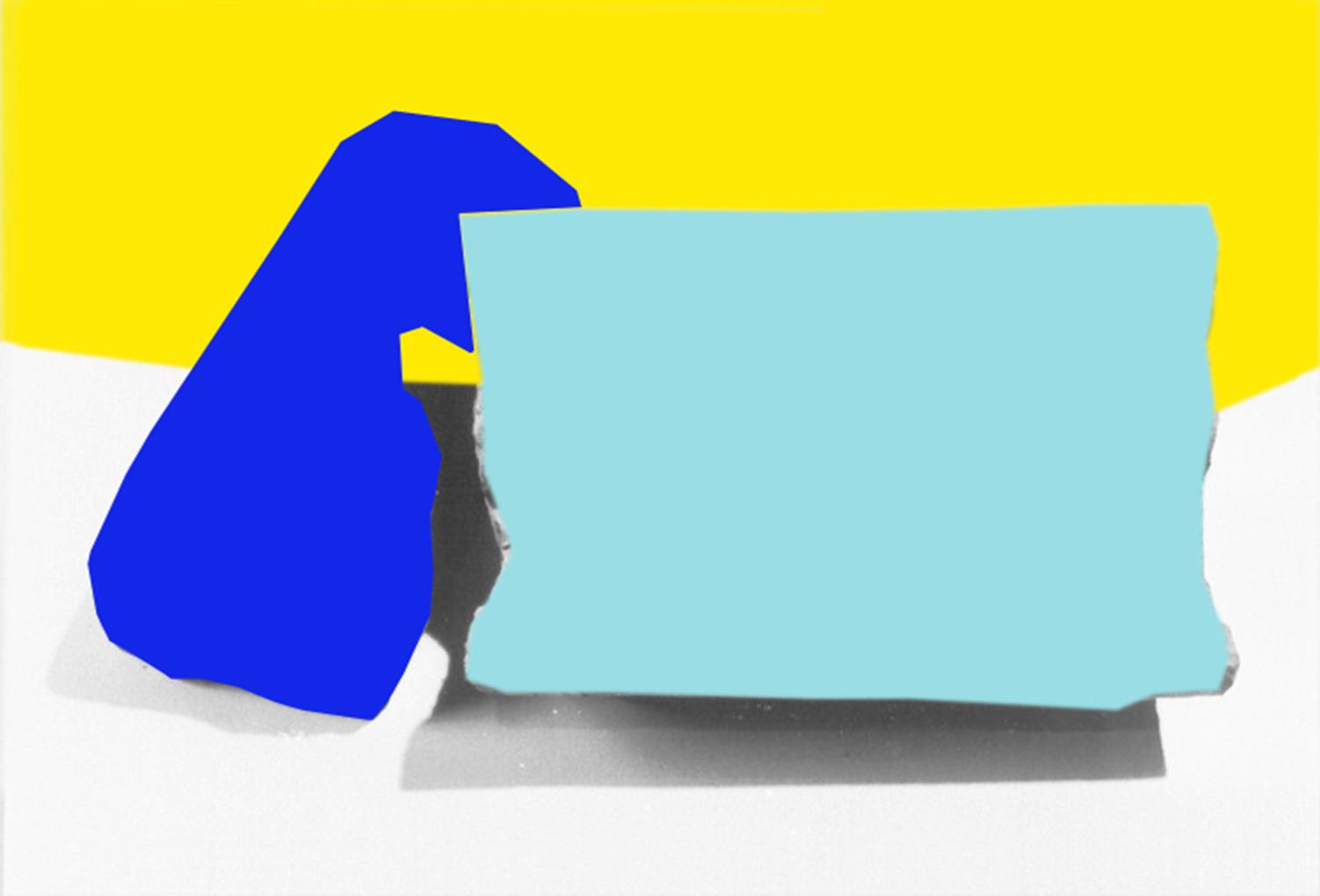
Die Kulturförderung des Kantons Zürich ist der Vielfalt verpflichtet. Grundlage dafür ist das Kulturförderungsgesetz, gemäss dem der Kanton «das geistige und kulturelle Leben zu Stadt und Land» fördert.
Auf dieser Seite
Neues Kulturleitbild
Die Fachstelle Kultur hat den Auftrag, ein neues Kulturleitbild für die kantonale Kulturförderung zu erarbeiten. Dieses soll die kulturpolitische Strategie und die langfristigen Ziele für die nächsten 8 bis 10 Jahre festlegen. Damit wird das aktuell gültige Leitbild Kulturförderung aus dem Jahr 2015 ersetzt. Der Erarbeitungsprozess startete im Herbst 2025 unter Einbezug der wichtigsten Anspruchsgruppen.
Der Kulturbereich steht vor grossen Herausforderungen: So ist zum Beispiel die soziale Sicherheit von Kulturschaffenden in vielen Bereichen weiterhin nicht gesichert. Oder der technologische Wandel und die Forderung nach einer nachhaltigen Ausrichtung (ökologisch, ökonomisch und sozial) sind zwei der Themen, die Kulturinstitutionen vor grosse Herausforderungen stellen. Die Frage, welche Auswirkungen diese und weitere Themen auf das Kulturleben hat, und wie die kantonale Kulturförderung darauf reagieren kann, steht im Zentrum der Diskussion.
Einbezug Kulturszene und weiterer Anspruchsgruppen
Im Herbst 2025 und Frühjahr 2026 finden Workshops mit Vertreter:innen des regionalen Kulturlebens und hiesiger Kulturinstitutionen, mit Partner:innen der Kulturförderung und kulturnahen Themenbereichen sowie mit Kunstschaffenden aller Bereiche statt. Damit soll sichergestellt werden, dass unterschiedliche Perspektiven in die Diskussion einfliessen.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
In vier partizipativen Veranstaltungen mit Künstler:innen und Vertreter:innen der unterschiedlichsten Anspruchsgruppen hat Ende November 2025 ein erster Austausch stattgefunden. Diskutiert wurde die Frage, welche Herausforderung die grossen Transformationsthemen (Demografie, Digitalisierung usw.) für die Kultur bringen und welche Anforderung sich daraus für die Kulturförderung ableiten lassen. Ausgangspunkt für die Diskussionen, die im Rahmen von World Cafés geführt wurden, waren drei Zukunftsszenarien. Diese wurden eigens für die Erarbeitung des Leitbilds entworfenund fokussieren auf die Kulturlandschaft des Kantons Zürich im Jahr 2035.
Die Rückmeldungen der rund 180 Teilnehmenden wurden in einem ersten Schritt zu 15 «Kernthemen» gebündelt, und in einem zweiten Schritt unter Einbezug der Begleitgremien zu «förderpolitischen Schwerpunkten» zusammengefasst.
Im Rahmen der zweiten Dialogwerkstatt informiert die Fachstelle über den Stand der Arbeiten und präsentiert die aktuellen Zwischenergebnisse. Die Teilnehmenden der Workshops sind eingeladen, die «förderpolitischen Schwerpunkte» zudiskutieren, zu ergänzen und zu priorisieren.
Die zweite Dialogwerkstatt, zu der alle 180 Teilnehmenden der ersten Workshopreihe erneut eingeladen werden, findet Ende März 2026 statt.

Begleitgremien
Eng begleitet wird der Erarbeitungsprozess von zwei Gremien. Diese werden in den verschiedenen Phasen des Prozesses die Zwischenergebnisse mit den Verantwortlichen der Fachstelle reflektieren und daraus die Grundlagen für den jeweils nächsten Schritt erarbeiten. Die beiden Gremien sind:
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Die Kulturförderungskommission ist ein 16köpfiges Fachgremium, das vom Regierungsrat gewählt wird und sich aus externen Fachpersonen zusammensetzt. Zu ihrer Aufgabe gehört es, die bei der Fachstelle eingereichten Gesuche zu beurteilen. In dieser Funktion bilden sie eine Schnittstelle zwischen der Verwaltung und der gesuchstellenden Öffentlichkeit und kennen die Anliegen und Bedürfnisse der Gesuchsteller:innen aus erster Hand.
Kerngruppe: Die Kerngruppe ist eine eigens für den Leitbildprozess zusammengestellte Gruppe, die den gesamten Prozess begleitet. Sie setzt sich aus Mitarbeiter:innen der Fachstelle und externen Expert:innen zusammen.
- Seraina Rohrer, Leiterin Fachstelle (Vorsitz)
- Gianna Conrad, Leitung Förderteam
- Daniel Fuchs, stv. Leitung Fachstelle
- Ellinor Landmann, Kulturjournalistin SRF
- Prisca Passigatti, Leitung Regionen
- Antje Schupp, Regisseurin, Performerin, Autorin
- Jane Wakefield, Unternehmensentwicklerin & Kulturunternehmerin mit Fokus Strategie und Transformation
Schwerpunkte aktuelle Kulturförderung
Dass und wie der Kanton Zürich die hiesige Kultur fördert, regeln das Kulturförderungsgesetz und die Kulturförderungsverordnung. Die strategische Ausrichtung der Kulturförderpolitik des Kantons Zürich legt der Regierungsrat im Leitbild Kulturförderung fest. Das zurzeit noch gültige Leitbild wurde im Februar 2015 vom Regierungsrat festgesetzt.
Schwerpunkte Kulturförderung
Das Leitbild Kulturförderung 2015 definiert vier Schwerpunkte:
Vorteile:
- Strahlkraft: Kultur – lokal verankert und international sichtbar
- Region: Regionale Kultur – Nachhaltigkeit durch Struktur
- Kreation: Von der Idee bis zum Dialog
- Teilhabe: Kultur in der Mehrzahl sehen
Aufgaben und Kompetenzen
Für die Kulturförderung sind im Kanton Zürich der Kantons- und der Regierungsrat, die Kulturförderungskommission sowie die Fachstelle Kultur zuständig. Ihnen kommen unterschiedliche Aufgaben und Kompetenzen zu.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Der Kantonsrat legt als oberste Behörde im Kanton die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Kulturförderung fest und definiert über das Budget die finanziellen Ressourcen der Kulturförderung. Zudem beschliesst er über den Kostenbeitrag an den Betrieb des Opernhauses und den Rahmenkredit an den Betrieb des Theaters Kanton Zürich. Darüber hinaus entscheidet der Kantonsrat bei Budgetmitteln über Investitionsbeiträgen über 4 Millionen Franken, bei Mitteln aus dem Kulturfonds entscheidet der Kantonsrat über Beiträge ab 2 Millionen Franken.
Der Regierungsrat definiert die kulturpolitischen Leitlinien und legt die qualitativen Kriterien der Kulturförderung in den Grundzügen fest. Weitere Aufgaben des Regierungsrates:
Vorteile:
- Genehmigung des Leitbildes für die Kulturförderung
- Wahl der Mitglieder der Kulturförderungskommission. Die Vorsteherin/der Vorsteher der Direktion JI präsidiert die Kulturförderungskommission.
- Gewährung wiederkehrender Betriebsbeiträge von jährlich über 250'000 Franken (bei vierjähriger Laufzeit) und von einmaligen Förderbeiträgen über 1 Mio. Franken
- Verleihung der kulturellen Auszeichnungen des Kantons Zürich (Kulturpreis, Förderpreis und Goldene Ehrenmedaille)
- Wahl der Abordnungen (Vertretungen des Kantons in die strategischen Gremien ausgewählter Kulturinstitutionen)
Die Kulturförderungskommission ist ein Fachgremium, das sich aus verwaltungsexternen Expertinnen und Experten aus der Kultur zusammensetzt. Sie berät den Regierungsrat bei der Vergabe der kulturellen Auszeichnungen, beurteilt die Gesuche für Projektförderung, Werkbeiträge und Atelierstipendien und gibt dazu Empfehlungen ab. Die Mitglieder können maximal acht Jahre der Kommission angehören.
Die Fachstelle Kultur ist der Direktion der Justiz und des Innern unterstellt. Sie ist verantwortlich für die Umsetzung des Kulturförderungsgesetzes und der Kulturverordnung sowie des Kulturleitbildes. Die Kompetenzen der Fachstelle sind dabei insbesondere
Vorteile:
- die Gewährung von einmaligen Projektbeiträgen und Ankäufen von Werken im Rahmen der Direktionskompetenz (1 Mio. Fr.)
- die Gewährung wiederkehrender Betriebsbeiträge unter 250'000 Franken (bei vierjähriger Laufzeit)
Die Aufgaben der Fachstelle Kultur sind
Vorteile:
- die Ausgestaltung von Programmen und Instrumenten für die Förderung von Kulturschaffenden, für die Projektförderung und für die Förderung von kulturellen Organisationen und Institutionen,
- die Ausgestaltung der Förderprogramme für die Gemeinden und die Mitarbeit beim Aufbau regionaler Förderstrukturen im Kanton,
- die Beratung der Direktion in kulturellen Fragen und Vorbereitung von Richtlinien der Direktion über die Kulturförderung,
- die Zusammenarbeit mit den beiden grossen Kulturbetrieben, bei denen der Kanton die finanzielle Hauptverantwortung trägt: dem Theater Kanton Zürich und dem Opernhaus sowie
- die Mitarbeit in strategischen Gremien grosser Kulturbetriebe und kulturpolitischer Kommissionen und Konferenzen.
Finanzierung der Kulturförderung
Zwei-Säulen-Modell
Gestützt auf die Empfehlungen der Studie «Finanzierung der Kulturförderung des Kantons Zürich» der Universität St.Gallen aus dem Jahr 2017 wurde im Kanton Zürich ab dem Jahr 2021 schrittweise das Zwei-Säulen-Modell umgesetzt. Nach der Übergangsphase im Zeitraum von 2021-2026, in welcher die beiden Säulen aufgebaut werden, ist folgende Mittelverwendung vorgesehen:
Vorteile:
- Mittel aus Kulturfonds - kurzfristig, flexibel, dynamisch: Finanzierung von Projektbeiträgen, Betriebsbeiträgen für kleine und mittlere Kulturinstitutionen, Investitionsbeiträgen für Bau- und Infrastrukturvorhaben von Kulturinstitutionen sowie Beiträgen an kulturelle Sonderprojekte von gemeinnützigen (Kultur-)Institutionen.
- Mittel aus Staatsmittel - langfristig, verlässlich: Finanzierung von Betriebsbeiträgen, die durch ein Spezialgesetz wie das Opernhausgesetz (OpHG) oder einen Rahmenkredit wie für das Theater Kanton Zürich geregelt ist. Finanzierung der Betriebsbeiträge für die grossen Kulturinstitutionen sowie die Beiträge an die Kulturprogramme der Gemeinden.
Studie Kulturfinanzierung ab 2022
Zur Klärung der Frage, wie die Finanzierung der Kulturförderung ab 2022 ausgestaltet und organisiert werden soll, wurde eine Studie in Auftrag gegeben.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Mit dem Beschluss 5125 vom Juli 2015 hat das Parlament die Finanzierung der Kulturförderung im Kanton Zürich neu geregelt: Für die Periode von 2017 bis 2021 wurden sämtliche Mittel für Betriebsbeiträge, Projektbeiträge, Werkbeiträge und Auszeichnungen aus dem Lotteriefonds des Kantons Zürich finanziert. Ausgenommen von dieser Regelung waren das Opernhaus Zürich, dessen Betriebsbeitrag gesetzlich verankert ist, sowie das Theater Kanton Zürich, das seinen jährlichen Betriebsbeitrag auf der Basis eines Rahmenkredits erhält, den der Kantonsrat jeweils für sechs Jahre bewilligt.
Angesichts der Befristung der zugesprochenen Mittel forderten mehrere politische Vorstösse den Regierungsrat auf, die Finanzierung der Kulturförderung ab 2022 auf eine neue, sichere Grundlage zu stellen. Bei dieser Neuordnung standen die folgenden drei Ziele im Zentrum:
- Sicherung der Kulturförderung – Erhalt des Bestehenden und Offenheit für Neues
- Vereinfachung der Zuständigkeit und Kompetenzen
- Transparenz der Finanzierungsquellen
Zur Klärung der Frage, wie die Finanzierung der Kulturförderung ab 2022 ausgestaltet und organisiert werden soll, hat Regierungsrätin Jacqueline Fehr, Direktion der Justiz und des Innern, beim Institut für Systemisches Management und Public Governance der Universität St. Gallen eine Studie in Auftrag gegeben. Ziel der Studie war es, die Entwicklung der Finanzierung der Kulturförderung im Kanton Zürich in den letzten rund 20 Jahren darzustellen und Szenarien für die Finanzierung der Kulturförderung nach 2022 zu skizzieren.
Die Studie entwirft drei Szenarien zu einer möglichen Neuordnung der Finanzierung der Kulturförderung im Kanton Zürich. Nach sorgfältiger Evaluierung favorisiert die Fachstelle Kultur das Szenario «Kulturfonds», das die Kriterien für ein transparentes Finanzierungsmodell am besten erfüllt und die Kulturfinanzierung auch langfristig sichert. Das Szenario schlägt vor, jährlich 25 Prozent der Lotteriefonds-Einnahmen in einen Kulturfonds zu übertragen, aus dem die gesamte Projektförderung, Betriebsbeiträge unter 200'000 Franken und Investitionen im Kulturbereich unter 500'000 Franken finanziert werden. Die Mittel für die Betriebsbeiträge über 200'000 Franken sollen ab 2022 ebenso wie die gesetzlich festgeschriebenen Beiträge an Opernhaus und Theater Kanton Zürich aus dem Staatshaushalt bereitgestellt werden. Investitionen über 500'000 Franken werden wie bisher aus dem allgemeinen Lotteriefonds finanziert.
Interkantonaler Kulturlastenausgleich
Der Interkantonale Kulturlastenausgleich ist eine Vereinbarung der Kantone Uri, Zug, Aargau, Luzern und Zürich. Ziel ist es, die interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler Kultureinrichtungen gemeinsam zu regeln.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Die Strahlkraft grosser Kulturhäuser prägt das positive Image ihrer Standortkantone und erhöht darüber hinaus die Lebens- und Wohnqualität der umliegenden Kantone.
Für die Standortkantone Luzern und Zürich bedeuten die grossen Kulturhäuser eine erhebliche finanzielle Belastung. Die Vereinbarungskantone Uri, Zug und Aargau erfahren durch die Nähe zu den kulturellen Leuchttürmen eine Attraktivitätssteigerung. Aus diesem Grund haben die fünf Kantone die Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler Kultureinrichtungen abgeschlossen. Die Vereinbarungskantone beteiligen sich an den Betriebssubventionen sowie an den Investitionskosten der überregionalen Kultureinrichtungen.
Die Kosten werden proportional zu den Publikumsströmen verteilt. Der Lastenausgleich erfolgt ausschliesslich für jene Kultureinrichtungen, die einen professionellen künstlerischen Betrieb führen, ein eigenes Ensemble beschäftigen und überregionale, nationale oder gar internationale Ausstrahlung erreichen. Aus dem Kanton Zürich sind dies das Opernhaus, das Schauspielhaus sowie die Tonhalle, aus dem Kanton Luzern sind dies das KKL, das Luzerner Theater sowie das Luzerner Sinfonieorchester.
Auch die Kantone Obwalden, Nidwalden und Schwyz, die der Vereinbarung nicht angehören, leisten Beiträge an die Standortkantone. Der Kanton Schaffhausen leistet zudem einen freiwilligen Beitrag an den Kanton Zürich.
Der Kulturlastenausgleich ist Teil der Neuen Finanz- und Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), wie sie seit 2008 in der Bundesverfassung verankert und im Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich konkretisiert ist. Der NFA ist als zentrales Instrument des gesamtschweizerischen Ressourcen- und Lastenausgleichs ein starker Pfeiler der föderalistischen Struktur.
Swisslos-Gelder/Kulturfonds
Das Lotteriefonds-Gesetz, das am 1. Januar 2021 in Kraft trat, legt fest, dass jährlich 30 Prozent des Gewinnanteils des Kantons Zürich aus der Genossenschaft Swisslos Interkantonale Landeslotterie in den Kulturfonds fliessen. Die Kulturfondsverordnung vom 24. Februar 2021 definiert die Vorhaben, die mit den Mitteln des Kulturfonds unterstützt werden sollen.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Neben der Ausrichtung von Projektbeiträgen und Betriebsbeiträgen für kleine und mittlere Kulturinstitutionen ist die Fachstelle Kultur seit Oktober 2021 auch für Investitionsbeiträge an Bau- und Infrastrukturvorhaben von Kulturinstitutionen sowie Beiträge an kulturelle Sonderprojekte von gemeinnützigen (Kultur-)Institutionen verantwortlich.
Covid Finanzhilfen
Die Folgen der Corona-Pandemie trafen Kulturschaffende und Kulturunternehmen besonders hart. Vom März 2020 bis Juni 2022 haben Bund und Kantone den Kulturbereich mit Covid-Finanzhilfen unterstützt. Geleistet wurden Ausfallentschädigungen und Beiträge an Transformationsprojekte.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Rund 100 Franken pro Kopf haben die Zürcher:innen zusammen mit dem Bund in den Corona-Jahren 2020 bis 2022 zur Rettung des kulturellen Angebots im Kanton beigetragen. Mit dieser Finanzhilfe konnte das Überleben der rund 700 Kulturunternehmen und die Existenz der über 1500 Kulturschaffenden gesichert werden, die Gesuche eingereicht und Ausfallsentschädigungen erhalten haben. Über 5'300 Gesuche um Ausfallentschädigungen wurden bei der Fachstelle Kultur eingereicht, davon konnten über 90 Prozent positiv beurteilt werden. Gut 150 Millionen Franken wurden während den 28 Monaten vom März 2020 bis zum Juni 2022 an Ausfallentschädigungen ausbezahlt. Der Löwenanteil kam mit rund 126 Millionen Kulturunternehmen zugute. Mit rund 23 Millionen Franken unterstützte der Kanton freischaffende und selbständige Kulturschaffende. In der gleichen Zeit wurden insgesamt 125 Gesuche um Transformationsprojekte an Kulturunternehmen mit einem Gesamtbetrag von 16.6 Mio. Franken unterstützt. Finanziert wurden die Ausfallentschädigungen und die Transformationsprojekte je zur Hälfte durch Bund und Kanton.
Im März 2020 hat der Bundesrat die Kultur als systemrelevant erklärt und mit der Covid-Notverordnung den Grundstein für die Covid-Finanzhilfen für den Kulturbereich gelegt. Im November 2020 wurde das Covid 19-Gesetz im Rahmen einer Volksabstimmung gutgeheissen, am 19. Dezember 2020 erlässt der Bundesrat die Covid-19-Kulturverordnung Am 17. Dezember 2021 beschliessen die eidgenössischen Räte die Verlängerung des Covid-19-Gesetzes. Kurz darauf, am 16. Februar 2022 hebt der Bundesrat die schweizweiten Massnahmen gegen die Coronapandemie grösstenteils auf. Am 13. April 2022 beschliesst der Bundesrat, die Ausfallentschädigungen an Kulturunternehmen und Kulturschaffende per Ende Juni 2022 einzustellen.
Kulturschaffende und Kulturunternehmen, die einen coronabedingten Ertragsausfall erlitten, konnten eine Ausfallentschädigung in Form einer nicht-rückzahlbaren Finanzhilfe beantragen. Die Ausfallentschädigung deckte max. 80% des Ertragsausfalls. Sie wurden subsidiär berechnet, d.h. ergänzend zu anderen Ansprüchen. Sie deckten damit den Schaden, für den keine anderweitige Deckung erfolgte (z.B. Corona Erwerbsersatzentschädigung der Ausgleichskassen, Nothilfe von Suisseculture Sociale, Kurzarbeitsentschädigung, Arbeitslosenentschädigung, Privatversicherung).
Bei den Kulturschaffenden konnten sowohl Selbständigerwerbende als auch Freischaffende eine Ausfallentschädigung beantragen. Bei den Kulturunternehmen konnten sowohl gemeinnützige als auch gewinnorientierte Unternehmen eine Ausfallentschädigung beantragen.
Ab Februar 2021 konnten Kulturunternehmen Gesuche für Transformationsprojekte einreichen. Im Rahmen dieses Unterstützungsprogramms wurden Vorhaben gefördert, welche die Anpassung von Kulturunternehmen an die durch die Covid-19-Epidemie veränderten Verhältnisse bezweckten und die strukturelle Neuausrichtung oder Publikumsgewinnung zum Gegenstand hatten. Dazu zählten Vorhaben, die z.B. eine Organisationsentwicklung im Kulturunternehmen zum Gegenstand hatten oder Projekte, welche die Wiedergewinnung von Publika oder die Erschliessung neuer Publikumssegmente zum Ziel hatten. Die Beiträge an Transformationsprojekte wurden in Form einer nicht-rückzahlbaren Finanzhilfe ausgerichtet.
Kulturpolitische Vorlagen
(Archiv)
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Am 23. September 2018 stimmte die Bevölkerung des Kantons Zürich über die Volksinitiative für ein Film- und Medienförderungsgesetz ab. Die Initiative wurde mit einem Stimmenanteil von 80.9 Prozent abgelehnt.
Die Volksinitiative forderte, kantonale Mittel für die Film- und Medienförderung gesetzlich zu verankern. Zum Zeitpunkt der Abstimmung standen der Kulturförderung jährlich insgesamt 23 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds zur Verfügung. Dazu kamen die Betriebsbeiträge an das Opernhaus Zürich und das Theater Kanton Zürich von jährlich rund 88 Millionen Franken.
Die Zürcher Filmstiftung erhielt 2018 einen jährlichen Beitrag von 4,65 Mio. Franken, was rund einem Fünftel der frei verfügbaren Fördermittel entsprach.
Ein eigenes Film- und Medienförderungsgesetz würde die Film- und Medienschaffenden gegenüber anderen Kulturschaffenden, wie zum Beispiel Musikern oder Autorinnen, bevorzugt behandeln. Damit stünde die Regelung der Film- und Medienförderung durch ein Spezialgesetz im Widerspruch zur Kulturpolitik des Kantons Zürich. Diese ist der kulturellen Vielfalt verpflichtet.
Kantonsrat und Regierungsrat empfahlen die Abstimmung zur Ablehnung.
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Telefonzeiten Sekretariat
Montag bis Freitag:
10:00 - 12:00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr