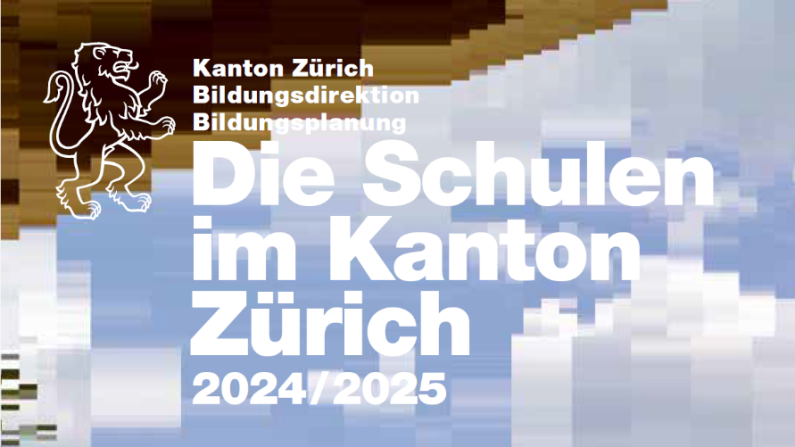Der Kindergarten im Kanton Zürich
Wie hat sich der Kindergarten in den letzten Jahren im Kanton Zürich entwickelt? Wie steht es um den Umgang mit der Vielfalt der Schülerinnen und Schüler, um die Qualität der Lehr- und Lernprozesse oder die Professionalität der Lehr- und Fachpersonen? Antworten darauf finden sich im Bericht «Situation des Kindergartens im Kanton Zürich» sowie in den Referaten und Befunden der Tagung «Vielfalt im Kindergarten».
Auf dieser Seite
Viele Herausforderungen
Der Kindergarten ist heute stark gefordert. Die vielgestaltige Gesellschaft zeigt sich darin wie unter einem Brennglas. Hier werden die Kinder zu Schülerinnen und Schülern. Hier starten sie ihre Schulzeit mit je eigenen Voraussetzungen, Kompetenzen, Erfahrungen und Hoffnungen. Wie gehen die Lehrkräfte in dieser entscheidenden Phase mit den Herausforderungen der Vielfalt um? Was bedeutet dies für die pädagogische Weiterentwicklung des Kindergartens? Welches Potenzial und welche Herausforderungen liegen in dieser Vielfalt?
Mit dem Volksschulgesetz von 2005 wurde der Kindergarten zu einem obligatorischen Teil der Volksschule. Seither stellen die beiden Kindergartenjahre das Fundament der Bildungslaufbahn dar. Einen Eindruck über den Stand des Kindergartens vermittelt der Bericht «Situation des Kindergartens im Kanton Zürich». Der Bericht basiert u.a. auf einer durch die Pädagogischen Hochschulen Bern und Zürich erstellten wissenschaftlichen Studie in 20 Kindergärten des Kantons und einer Online-Befragung sämtlicher Kindergartenlehrpersonen.
Die Vielfalt im Fokus
Am 1. Februar 2020 veranstaltete die Bildungsdirektion – ausgehend von den Ergebnissen des Berichts «Situation des Kindergartens im Kanton Zürich» – eine Tagung zum Thema Vielfalt. Ziel war, ein gemeinsames Verständnis zwischen Praxis und Wissenschaft zum Umgang mit Vielfalt im Kindergarten zu schaffen. Der Austausch zu diesen Fragen gab vor allem auch den Stimmen aus der Praxis Gewicht. An der gut besuchten Tagung an der Universität Irchel nahmen 250 Personen teil, mehrheitlich Lehrpersonen des Kindergartens im Kanton Zürich sowie Fachpersonen aus der weiteren Praxis und der Wissenschaft. Neben zwei Keynotes thematisierten acht Workshops vertiefende Fragen dazu (siehe Videos mit den Workshopergebnissen). Nach der Begrüssung durch Bildungsdirektorin Dr. Silvia Steiner hielten Prof. Dr. Doris Edelmann und Prof. Dr. Evelyne Wannack, beide von der PH Bern, die Hauptreferate. Den Abschluss machte der Komiker, Punk-Musiker und ursprüngliche Kindergarten-Lehrer Dominic Deville.
Hauptreferate
«Vielfalt im Kindergarten begreifen und pädagogisch gestalten»
Kernaussage: Der Kindergarten muss bereit sein für die Kinder, und nicht die Kinder müssen bereit sein für den Kindergarten.
Prof. Dr. Doris Edelmann
«Unterricht mit Fokus auf Individualisierung anlegen»
Kernaussage: Es gibt viele didaktische Möglichkeiten zur Individualisierung des Unterrichts.
Prof. Dr. Evelyne Wannack
Ergebnisse aus den Workshops
«Kindergartenstart»
Die Vielfalt der Kinder ist insbesondere am Schuljahresanfang eine grosse Herausforderung. Im Kindergarten kommen Kinder mit sehr unterschiedlichen Bildungserfahrungen zusammen. Der Eintritt in den Kindergarten ist im Bildungsverlauf sowohl individuell als auch systemisch sehr bedeutsam. Zugleich werden vielfältige Erwartungen an die Kinder und die Eltern gerichtet.
Co-Leitung: Tamara Carigiet, PHBern & Andrea Eichmüller, Kindergarten Binzholz, Wald)

«Freies Spiel»
Der Einsatz von geführten und offenen Unterrichtssequenzen erlaubt eine Rhythmisierung, die einen sinnvollen Wechsel zwischen Phasen der Konzentration und der Entspannung ermöglicht. Insbesondere Spiel- und Lernangebote im freien Spiel tragen den Dimensionen Interessen, Entwicklungs- und Lernstand zur Individualisierung Rechnung. Diese Dimensionen bleiben auch in der Primarschule und darüber hinaus relevant. Insofern wäre der Kindergarten als positives Vorbild für alle Bildungsstufen zu beachten.
Co-Leitung: Sabina Staub, PHBern & Gabi Fink, Kindergarten Schmittenacher, Weisslingen

«Sprachförderung»
Kinder treten mit sehr unterschiedlichen Sprachkompetenzen in den Kindergarten ein, was die Integrationsfunktion des Kindergartens zusätzlich betont. Für viele Kinder – und deren Eltern – ist der Kindergarten der erste Kontakt mit Deutsch als Schul- und Bildungssprache. Die Sprachförderung ist auch deswegen ein wichtiges Thema im Austausch mit den Eltern.
Co-Leitung: Hansjakob Schneider, PHZH & Eliane Studer Kilchenmann, Kindergarten Breiten, Affoltern a. A.

«Übergang in die Primarschule»
Der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule ist durch vielfältige Erwartungen an die Kinder und die Eltern befrachtet. Dabei spielen Vorstellungen von Schule, Lernen und Leistung eine wichtige Rolle. Ein wichtiges Stichwort ist dabei der Übertritt in die erste Klasse mit den begleitenden Vorstellungen darüber, wozu Kinder zum Zeitpunkt dieses Übertritts in der Lage sind, was sie wissen und können sollten, um am Unterricht der ersten Primarschulklasse teilnehmen zu können.
Co-Leitung: Gisela Unterweger, PHZH & Maja Beutler, Kindergarten Erismannhof, Zürich

«Das entwicklungsorientierte Lernen»
Die Integration des Kindergartens in die Volksschule ist zwar bereits in vielen Bereichen vollzogen. Im pädagogischen Bereich hat sie aber erst gerade begonnen: Mit dem Lehrplan 21 wird der Kindergarten als Teil des sukzessiven Aufbaus von Kompetenzen verstanden. Für den 1. Zyklus wurden als Ergänzung zum fachorientierten Kompetenzaufbau die entwicklungsorientierten Zugänge formuliert. Künftig gilt es also, im Kindergarten das entwicklungsorientierte und fachbezogene Lernen zu kombinieren.
Co-Leitung: Catherine Lieger, PHZH & Michaela Siggelkow, Kindergarten Flaach

«Besondere pädagogische Bedürfnisse»
Im Zuge der Bestrebungen zur Integration aller Kinder in die Regelschule sieht sich der Kindergarten vermehrt mit der Aufgabe der Begleitung von Kindern mit Behinderung konfrontiert. Dabei kommt dem Kindergarten eine wichtige Bedeutung im Übergang in den Kindergarten und im Anschluss an die sonderpädagogische Unterstützung im Vorschulbereich (Heilpädagogische Früherziehung) zu. Die daraus entstehenden Schnittstellen sind für das Gelingen der Integration sehr wichtig.
Co-Leitung: Matthias Lütolf, HfH & Ursula Stierli, Kindergarten Dorf, Knonau

«Elternzusammenarbeit»
Die Elternzusammenarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für einen gelungenen Start in die Volksschule. Dies gilt im Speziellen für Kinder und Familien mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.
Co-Leitung: Claudia Schletti, PHBern & Ursina Zindel, Kindergarten Bettlen, Küsnacht

«Zusammenarbeit mit dem Frühbereich»
Kinder treten immer häufiger aus der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) in den Kindergarten ein. Dadurch entsteht eine bedeutsame Schnittstelle zwischen FBBE und Kindergarten. Themen an dieser Schnittstelle sind pädagogische Anschlussfähigkeit und Kooperation. Obschon gerade die frühen Übergangsprozesse im Bildungsverlauf sowohl individuell als auch systemisch sehr bedeutsam sind, ist die Schnittstelle am Übergang von der FBBE – und aus der Familie – in den Kindergarten bislang wenig berücksichtigt und bearbeitet worden.
Co-Leitung: Kathleen Panitz, PH FHNW & Brigitte Fleuti, Kindergarten Widmer, Langnau a. A.

Impressionen
-
Plenumsvortrag von Prof. Dr. Doris Edelmann -
Plenumsvortrag von Prof. Dr. Eveline Wannack -
Der Komiker und Schriftsteller Dominic Deville, der sich ursprünglich zum Kindergärtner aus-bilden liess, bestritt den unterhaltsamen Teil der Veranstaltung.
Schlagworte
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Bildungsplanung